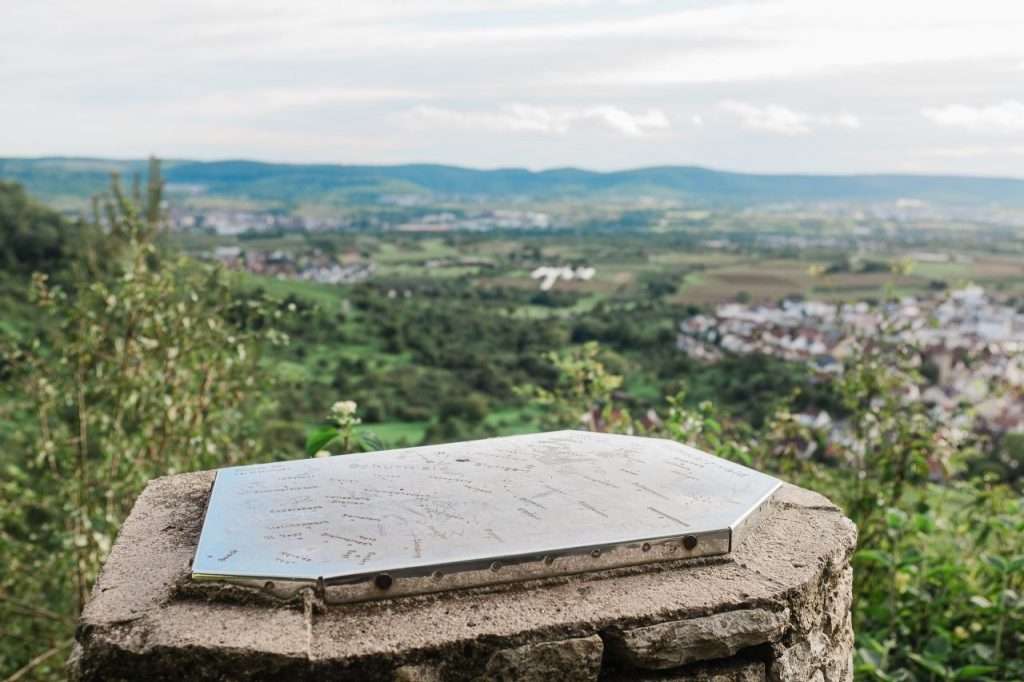Um „Wasser – unsere wichtigste Lebensgrundlage“ ging es bei der Wanderung am Zipfelbach mit Kreisrat Daniel Baier und unserer Landesvorsitzenden Lena Schwelling. Daniels umfangreiches Wissen über die Natur und seine Begeisterung für Gewässer sprang auf die rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über. Hier sein Nachbericht:
„Zum Ende der Ferien hatten wir Besuch unserer Landesvorsitzenden Lena Schwelling. Swantje Sperling hatte gemeinsam mit uns zum Wandern am Zipfelbach eingeladen, und 40 interessierte Gäste kamen zu unserer Exkursion durch das Naturschutzgebiet Oberes Zipfelbachtal. Auf einer Strecke von sieben Kilometern machten wir Station zu folgenden Themen:
- Das obere Zipfelbachtal: Das jüngste Naturschutzgebiet im Rems-Murr-Kreis
- Renaturierungen und Belastungen der Gewässer: Durchgängigkeit und Strukturreichtum
- Kläranlagen: Stilllegungen der Vergangenheit, Ausblick auf die Zukunft
- Wald und Wasser: Speicher und Rückhalt – Altlasten und ihre Auswirkungen (Deponie Breuningsweiler)
- Die Höhlensysteme im Keuperbergland: Geologische Besonderheiten
- Naturdenkmale und der schönste Blick über das Stuttgarter Tal
Am Anfang der Tour sprachen wir über das Schicksalsjahr für den Zipfelbach, das Jahr 1979. Die Grünen erzielten gerade erste Erfolge bei der Europawahl und erreichten in Baden-Württemberg ein überdurchschnittliches Ergebnis von 4,7 Prozent, in 44 Wahlkreisen lagen sie über der 5 Prozent-Hürde. Ein Jahr später zogen sechs Abgeordnete erstmals in den Landtag von Baden-Württemberg ein, darunter ein gewisser Winfried Kretschmann. Die Zeit war geprägt von den Nachwirkungen der Wirtschaftswunderzeit, die Umwelt litt unter dem Raubbau an der Natur. Auch in Winnenden regte sich Unmut über die immer sichtbareren Folgen der Umweltzerstörung. Dass Menschen dies nicht mehr hinnehmen wollten, ist einer der wichtigsten Gründe, warum unsere Partei entstanden ist.
Die erste fachliche Station war die alte Kläranlage in Hanweiler und der neben ihr liegende Trombach. Ein Teil des Trombaches ist verdolt und fließt in Rohren unterhalb der Wiesen. An der Stelle, an der der Bach wieder zutage tritt, sieht man sofort, dass sich die typische uferbegleitende Vegetation angesiedelt hat. Hier konnte schön die Bedeutung der Gewässerrandstreifen für die Ökologie und für die Umwelt im Allgemeinen verdeutlicht werden, denn Gewässerrandstreifen sind in der Lage, einen Großteil der Schadstoffe bereits vor Eintritt in das Gewässer zu eliminieren. Vor allem in der Jahren 1930 bis 1970 wurden jedoch viele Bäche begradigt und die Gewässerrandstreifen gingen weitgehend verloren. Doch ihr Reaktivieren ist teuer, alleine die oben erwähnte Verdolung wieder zurückzubauen und dem Bach seinen natürlichen Verlauf wiederzugeben, kostet mehr als eine halbe Million Euro.
Ein weiterer Punkt an dieser Station ist die Funktion der Kläranlagen. Es gibt vier verschiedenen Klärstufen: die mechanische Reinigung, die biologische und die chemische, die schon in vielen Kläranlagen integriert sind. Noch nicht sehr häufig eingesetzt wird die vierte Reinigungsstufe, die in der Lage ist, auch Spurenstoffe wie Arzneimittelrückstände zu entfernen. Im Zipfelbachtal selbst gab es bis 1982/1983 zwei Kläranlagen, eine in Hanweiler, die andere in Breuningsweiler. Beide Anlagen waren nur mit einer mechanischen Klärstufe versehen und verhinderten damit nur wenig den schädlichen Eintrag in den Zipfelbach. Im Zuge der Neustrukturierung der Abwasserbehandlung wurden diese Kläranlagen geschlossen und das anfallende Abwasser über neu errichtetete Kanäle zur größeren Kläranlage am Ortsausgang von Winnenden geleitet.
Nur wenige hundert Meter später steht unsere Gruppe nun im jüngsten Naturschutzgebiet des Rems-Murr-Kreises, dem oberen Zipfelbachtal. Das obere Zipfelbachtal ist seit 2009 als Naturschutzgebiet ausgewiesen, aber dessen Entstehungsgeschichte geht im Grunde genommen auf das Jahr 1979 zurück. Doch dazu mehr bei der nächsten Station.

v.l.n.r.: Kreisrat Daniel Baier, GRÜNE Landesvorsitzende Lena Schwelling, Landtagsabgeordnete Swantje Sperling Bild: Franzi Krämer Fotografie
Im Naturschutzgebiet Oberes Zipfelbachtal
Das Besondere an dem Naturschutzgebiet verrät schon seine korrekte Bezeichnung Oberes Zipfelbachtal mit Seitenklinge und Teilen des Sonnenbergs. Der Strukturreichtum des Tals mit den Zipfelbach-Klingen, extensiv genutztem Grünland, sumpfigen Feuchtwiesen im Tal und Streuobstwiesen am Sonnenhang beherbergt mehr als tausend Tier- und Pflanzenarten. Der örtliche NABU pflegt liebevoll mehr als 3 Hektar des strukturreichen Gebiets und schafft Lebensräume für viele verschiedene Arten. Anlässlich seines hundertjährigen Jubiläums hat der NABU ein Buch zum Naturschutzgebiet herausgegeben, das viele Informationen und Hintergründe zu diesem Tal bietet.
Die großen dauerfeuchten Retentionsflächen bieten einen hohen Regenrückhalt. Das dient zum einen dem Abmildern von Hochwasser, aber ganz besonders dazu, dass Wasser in den Boden versickern kann. Hochwasser sind als Extremwetterereignis zwar spektakulärer und schadensreicher und auch sie werden durch den Klimawandel häufiger, aber ein mindestens ebenso großes Problem stellen die immer häufiger und länger andauernden Dürreperioden dar. In der Vergangenheit ging es in erster Linie darum, das Wasser schnell abzuleiten, heute geht es darum Wasser in der Fläche zu halten. Auch die Stadt Winnenden realisiert hier mit dem Teichhuhnbiotop eine Rückhaltefläche für den Geltnerwiesenbach, einem kurzen Zulauf des Zipfelbachs aus der Höhe Breuningsweilers. Die Verbindung zum Zipfelbach ist leider noch verdolt.
Zurück ins Jahr 1979 ging es beim nächsten Stopp. Mit Blick auf die ehemalige Kläranlage Breuningsweiler, die nun als Biotop vom Angelverein betreut wird, kommt die eigentliche Geburtsstunde des Naturschutzgebiets zur Sprache.
Der Fischerstreit
Als zu Zeiten des Wirtschaftswunders immer mehr Abfälle einer prosperierenden Volkswirtschaft anfielen, entschied man sich in Winnenden – und war damit beileibe keine Ausnahme im Land – dazu eine der Klingen der Quellbäche des Zipfelbachs mit Müll aufzufüllen: 30 Meter hoch, 100.000 Kubikmeter an Haus-, Sperr-, Gewerbe- und Industriemüll. Ohne Versiegelung und ohne Drainage, um die giftigen Stoffe abzuleiten. Das ökologische Gleichgewicht war gestört, der Bach verödete langsam und wurde an vielen Stellen lebensfeindlich.
Einmal wurde in einem Fischteich oberhalb der Deponie eine Schleuse geöffnet, die Fische wurden in den kontaminierten Bereich geschwemmt und verendeten zu Dutzenden. Erste Vorwürfe wegen der Verschmutzung gab es bereits 1969, 1972 wurden sie wiederholt, aber nichts geschah.
Dem Einsatz zweier Lehrer des Büchnergymnasiums war es zu verdanken, dass dem Thema im Jahr 1979 wieder Aufmerksamkeit zuteilwurde. Gemeinsam mit ihrem Chemie-LK nahmen sie eine chemische Analyse an den Austrittstellen der Sickerwässer der Deponie und in den Bereichen der Kläranlagen vor. Die Ergebnisse waren erschütternd. Manche Grenzwerte überstiegen das zigfache des heute zulässigen. Mit diesen Ergebnissen traten sie am Juni 1979 an die Öffentlichkeit – der Titel: Schwarzbuch „Oberes Zipfelbachtal. Wenige Tage später traf man sich mit den Behörden zu einem gemeinsamen Begehungstermin.
Gleichzeitig speist der Zipfelbach das Grundwasser und versorgt eine Reihe von Dörfern mit Trinkwasser. Diese Vorstellung dürfte vielleicht manchen erschrecken, wenn er das Wasser der Quellbäche genauer betrachtet und dessen üblen Geruch wahrnimmt.
Schwarzbuch „Oberes Zipfelbachtal“
Erste Kritik wurde schnell laut, man warf den Schüler:innen schlechten Stil vor so in die Öffentlichkeit zu gehen und überhaupt – der Zipfelbach sei doch nicht lebensfeindlich. Den eingesetzten Regenbogenforellen, für die die Fischer den Zipfelbach zur Aufzucht nutzen, gehe es gut. Auch der Fischereiverband war der Meinung, dass es so schlecht nicht um den Zipfelbach stehe und die Behörden auch schnellstens gehandelt hätten. Im direkten Gespräch hätte sich das alles doch klären lassen. Man erinnere sich an die Jahre 1969 und 1972.
Die Befischung ergab fünf wunderschöne Regenbogenforellen, schnell wurde nun seitens der Deponiegegner der Vorwurf laut, sie seien eingesetzt gewesen. Man debattierte und stritt in der Öffentlichkeit über Leserbriefe in der Winnender Zeitung. Am Ende war man sich dann aber doch einig, dass am Zipfelbach etwas passieren müsse, um die giftigen Sickerwässer von der Natur fernzuhalten. Auch das Landratsamt schrieb nach Untersuchung wenig nüchtern: „Ca 10 Meter von dem Pegel XXII entfernt, strömt dunkelgefärbtes Wasser unterhalb eines Felsens hervor. Der ekelerregende Geruch deutet auf Sickerwasser hin“. Die Mess-Ergebnisse des Chemie-Leistungskurses wurden größtenteils bestätigt.
Der öffentliche Druck war da, die Verwaltung musste reagieren und beauftragte Gutachten zur Sanierung der Schäden. 1982/1983 wurden schließlich neue Kanäle für das Abwasser aus Breuningsweiler und Hanweiler errichtet und eine Sickerdrainage für die Deponie erstellt, die Deponie wurde endgültig im Jahr 1985 geschlossen.
Die Natur bekam Zeit zur Regeneration. Sie tat das so gut, dass 2009 die Entscheidung getroffen wurde, das Zipfelbachtal zum Naturschutzgebiet zu erklären. Bis heute und noch für viele Jahrzehnte müssen allerdings die giftigen Sickerwässer aufwändig aufgefangen und entsorgt werden. Schäden an der Umwelt sind oft Ewigkeitskosten. Trotzdem ist das Obere Zipfelbachtal heute der schönste und wertvollste Naturraum von Winnenden – und auch der Verdienst einer mutigen Klasse und des ehrenamtlichen Engagements ihrer Lehrer.
Wald und Wasser
Malerisch schlängelt sich der Bach in einer tiefen Klinge durch den Wald. Lichtungen offenbaren die uralten Wildwege. Der Müll schlummert unter der Vegetation. Nur am ehemaligen Naturdenkmal, dem Wasserfall, erkennt man die Folgen. Eine Quelle ist durch die Deponie beinahe versiegt. Heute, nach Regen am Morgen und in der Nacht, haben wir Glück, man hört es ein wenig plätschern. Meist ist es dort inzwischen sehr still. Wir halten kurz inne.
Unser nächstes Ziel ist ein kleiner See in einer Senke. Er wurde vor wenigen Jahren künstlich angelegt. Auch in der Forstwirtschaft spielt es eine immer größere Rolle, das Wasser im Boden zu halten und es nicht gleich abzuleiten. Die vielfältigen Funktionen dieses kleinen Biotops und dessen Bewohner erklärt der Forst mit schönen und lehrreichen Schautafeln für alle, die den Wald besuchen.
Der Regenrückhalt von Laubwäldern ist deutlich höher ist als der von Nadelwäldern. Eine einzelne Buche kann im Jahr tausende Liter Wasser filtern. Der Wald ist ein entscheidender Faktor zur Grundwasserbildung und zur Regenbildung und von elementarer Bedeutung für das Mikroklima seiner näheren Umgebung. Er ist so viel mehr als Wirtschaftswald oder Erholungswald.
Weiter ging es ein ganzes Stück durch den schönen alten Wald zwischen Buoch und Korb. Die Sonne stand bereits tief, als die Gruppe die Höhlen von Korb erreicht. Fast alle Höhlen auf der Welt sind unter dem Einfluss von Wasser entstanden. Der geologische Untergrund spielt bei der Grundwasserbildung eine große Rolle. Hier ist es Keuperbergland, das von vielen unterschiedlich tiefen, wasserführenden Schichten geprägt ist. Zudem sind die Höhlen wichtiger Lebensraum für viele Waldbewohner wie den Dachs, den Fuchs oder eine Vielzahl an Fledermausarten. Die Eingänge wurden vor Jahren vergittert. Erstaunt sind viele, als sie erfahren, dass wir in einer Mittelgebirgsregion leben.
Am Ende der Wanderung offenbarte sich die ganze Schönheit des vorderen Remstals am Korber Hörnle mit Blick auf die Siedlungsflächen von Stuttgarter und seiner Region.“